Trend zur Teilzeitarbeit: Finanzielle Engpässe im Alter
19.08.2025

Immer mehr Arbeitnehmer reduzieren ihr Arbeitspensum aus eigenem Antrieb. Wir richten den Blick auf die langfristigen finanziellen Auswirkungen, denen man in jüngeren Jahren nicht unbedingt die nötige Aufmerksamkeit schenkt. Kurz: Wer wenig einbezahlt, hat später auch (zu) wenig.
Fangen wir am Ende an. Mit dem Übergang in die Pensionierung verändert sich die Einkommenssituation für die meisten Menschen deutlich. Entscheidend ist nun die Frage, was an Rentenansprüchen und Vorsorgeguthaben vorhanden ist. Oder anders gesagt: was man in den vorangegangenen Jahrzehnten in die Vorsorgetöpfe der ersten, zweiten und dritten Säule einbezahlt hat. Das hat viel mit der Höhe des Erwerbseinkommens zu tun, das man während seiner Berufstätigkeit erzielt hat.
Hier gibt es eine doppelte Krux zu beachten. Erstens gibt es eine Eintrittsschwelle. Erst ab einem Lohn von 22 680 Franken (Wert für 2025) wird man in die berufliche Vorsorge aufgenommen. Zweitens werden nur diejenigen Lohnanteile berücksichtigt, die über dem bereits erwähnten koordinierten Lohn liegen. Der Wert dafür liegt für das Jahr 2025 bei 26 460 Franken. Nur die Lohnanteile, die über dieser Schwelle liegen, werden bei der Berechnung des Lohnabzugs berücksichtigt. Bei einem Teilzeitpensum wird der Sparanteil also geringer. Es versteht sich in der Folge von selbst, dass der Spartopf der beruflichen Vorsorge dereinst bei der Pensionierung weniger gefüllt ist. Das heisst, das angesparte Kapital oder die daraus errechnete Rente fallen tiefer aus als bei einer Vollbeschäftigung. Die skizzierten Regelungen betreffen das BVG-Obligatorium. Es steht den Unternehmen frei, überobligatorisch andere Lösungen zu finden.
Besonders kritisch: Wenn jemand zwei oder drei Teilzeitjobs ausführt und jeweils unter der Eintrittsschwelle von gegenwärtig 22 680 Franken beziehungsweise dem koordinierten Lohn von 26 640 Franken bleibt, findet in der 2. Säule überhaupt kein Alterssparen statt. Das wird nach der Pensionierung mit erheblichen finanziellen Einbussen verbunden sein.
Ein dritter Baustein für eine möglichst gute finanzielle Situation nach der Pensionierung ist die Vorsorge im Rahmen der Säule 3a. Hier können Arbeitnehmer im Angestelltenverhältnis bis zu 7258 Franken (Wert für 2025) in ein persönliches Vorsorgekonto einzahlen, dessen kumulierte und verzinste Ersparnisse sie im Umfeld der Pensionierung als Kapital wieder beziehen können. Ausserdem können sie die geleisteten jährlichen Zahlungen in der Steuererklärung vom Einkommen abziehen. Alterssparen und Steuern sparen gehen hier also Hand in Hand. Personen ohne Pensionskasse können bis zu 20 Prozent ihres Nettoerwerbseinkommens einzahlen, jedoch höchstens 36 288 Franken (Wert für 2025).
Wer nun sein Vollzeitpensum auf ein Teilzeitpensum absenkt, verfügt in vielen Fällen nicht mehr über ausreichend Mittel, die für eine Einzahlung in die Säule 3a «übrig» bleiben. So entsteht – in den meisten Fällen unbewusst – eine finanzielle Lücke, die sich nach der Pensionierung bemerkbar machen wird.
Quelle: Treuhand | Suisse

Immer mehr Arbeitnehmer reduzieren ihr Arbeitspensum aus eigenem Antrieb. Wir richten den Blick auf die langfristigen finanziellen Auswirkungen, denen man in jüngeren Jahren nicht unbedingt die nötige Aufmerksamkeit schenkt. Kurz: Wer wenig einbezahlt, hat später auch (zu) wenig.
Fangen wir am Ende an. Mit dem Übergang in die Pensionierung verändert sich die Einkommenssituation für die meisten Menschen deutlich. Entscheidend ist nun die Frage, was an Rentenansprüchen und Vorsorgeguthaben vorhanden ist. Oder anders gesagt: was man in den vorangegangenen Jahrzehnten in die Vorsorgetöpfe der ersten, zweiten und dritten Säule einbezahlt hat. Das hat viel mit der Höhe des Erwerbseinkommens zu tun, das man während seiner Berufstätigkeit erzielt hat.
Erste Säule: AHV, IV, EO
Wer im Angestelltenverhältnis tätig ist, kennt die Lohnabzüge. Sie werden auf der Lohnabrechnung ausgewiesen. So werden dem Arbeitnehmer für die 1. Säule (AHV, IV, EO) 5,3 Prozent des Bruttolohns abgezogen. Nochmals den gleichen Betrag bezahlt der Arbeitgeber ein. Naturgemäss sind die so getätigten Einzahlungen in die Altersvorsorge bei geringem Einkommen und/oder bei Teilzeitarbeit unter dem Strich tiefer. Dies wirkt sich auf lange Sicht ganz direkt auf die Höhe der AHV-Rente aus, auf die man nach der Pensionierung Anrecht hat. Für die Berechnung des tatsächlichen Betrags sind die Einzahlungen massgeblich, die man während seines Erwerbslebens getätigt hat. Die daraus resultierende Spanne ist sehr gross. So beträgt die jährliche Maximalrente im Moment 2520 Franken pro Monat, die Minimalrente aber nur 1260 Franken, also die Hälfte.Zweite Säule: Berufliche Vorsorge
Mit dem 25. Lebensjahr setzt für Arbeitnehmer im Angestelltenverhältnis das Alterssparen im Rahmen der beruflichen Vorsorge ein. Von da an geht ein prozentualer Anteil des «koordinierten Lohns» als Sparbeitrag in die 2. Säule. Bezahlt werden diese BVG-Beiträge mindestens zur Hälfte durch den Arbeitgeber, die andere Hälfte wird dem Arbeitnehmer direkt vom Lohn abgezogen. Gewisse Arbeitgeber bezahlen mehr als die Hälfte, das bleibt ihnen überlassen.Hier gibt es eine doppelte Krux zu beachten. Erstens gibt es eine Eintrittsschwelle. Erst ab einem Lohn von 22 680 Franken (Wert für 2025) wird man in die berufliche Vorsorge aufgenommen. Zweitens werden nur diejenigen Lohnanteile berücksichtigt, die über dem bereits erwähnten koordinierten Lohn liegen. Der Wert dafür liegt für das Jahr 2025 bei 26 460 Franken. Nur die Lohnanteile, die über dieser Schwelle liegen, werden bei der Berechnung des Lohnabzugs berücksichtigt. Bei einem Teilzeitpensum wird der Sparanteil also geringer. Es versteht sich in der Folge von selbst, dass der Spartopf der beruflichen Vorsorge dereinst bei der Pensionierung weniger gefüllt ist. Das heisst, das angesparte Kapital oder die daraus errechnete Rente fallen tiefer aus als bei einer Vollbeschäftigung. Die skizzierten Regelungen betreffen das BVG-Obligatorium. Es steht den Unternehmen frei, überobligatorisch andere Lösungen zu finden.
Besonders kritisch: Wenn jemand zwei oder drei Teilzeitjobs ausführt und jeweils unter der Eintrittsschwelle von gegenwärtig 22 680 Franken beziehungsweise dem koordinierten Lohn von 26 640 Franken bleibt, findet in der 2. Säule überhaupt kein Alterssparen statt. Das wird nach der Pensionierung mit erheblichen finanziellen Einbussen verbunden sein.
Freiwillige gebundene Vorsorge
Ein dritter Baustein für eine möglichst gute finanzielle Situation nach der Pensionierung ist die Vorsorge im Rahmen der Säule 3a. Hier können Arbeitnehmer im Angestelltenverhältnis bis zu 7258 Franken (Wert für 2025) in ein persönliches Vorsorgekonto einzahlen, dessen kumulierte und verzinste Ersparnisse sie im Umfeld der Pensionierung als Kapital wieder beziehen können. Ausserdem können sie die geleisteten jährlichen Zahlungen in der Steuererklärung vom Einkommen abziehen. Alterssparen und Steuern sparen gehen hier also Hand in Hand. Personen ohne Pensionskasse können bis zu 20 Prozent ihres Nettoerwerbseinkommens einzahlen, jedoch höchstens 36 288 Franken (Wert für 2025).
Wer nun sein Vollzeitpensum auf ein Teilzeitpensum absenkt, verfügt in vielen Fällen nicht mehr über ausreichend Mittel, die für eine Einzahlung in die Säule 3a «übrig» bleiben. So entsteht – in den meisten Fällen unbewusst – eine finanzielle Lücke, die sich nach der Pensionierung bemerkbar machen wird.
Quelle: Treuhand | Suisse

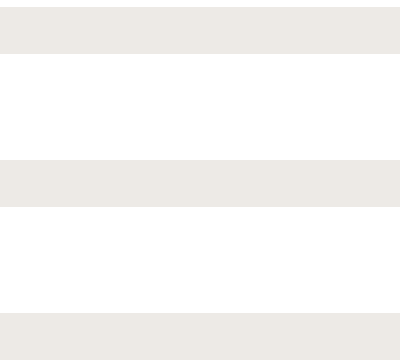
 Startseite
Startseite Dienstleistungen
Dienstleistungen Team
Team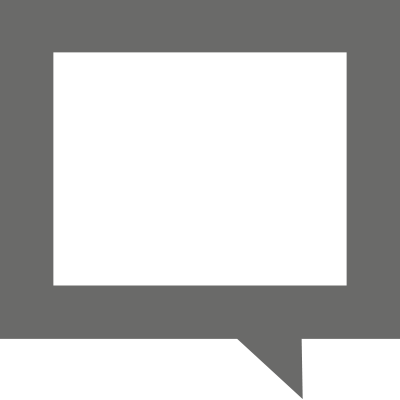 Kontakt
Kontakt



