Besteuerung von Wohneigentum: Abzugsmöglichkeiten nutzen
19.08.2025

Am 28. September hat die Stimmbevölkerung der Abschaffung des Eigenmietwerts zugestimmt. Damit fallen künftig auch die steuerlichen Abzüge für Unterhalt und Sanierungsarbeiten am selbst genutzten Wohneigentum weg. Jetzt bleibt noch Zeit, um anstehende Projekte voranzutreiben.
Es steht noch nicht fest, wann die reformierte Besteuerung von Wohneigentum in Kraft tritt. Der Entscheid liegt beim Bundesrat und auch die Kantone haben noch Hausaufgaben zu erledigen. Jetzt dürfte es für viele Wohneigentümer interessant sein, anstehende Sanierungsprojekte am selbstgenutzten Wohneigentum anzugehen, um noch von den bisherigen Abzugsmöglichkeiten zu profitieren.
Meistens beinhalten solche Projekte aber auch wertvermehrende Elemente: mehr und bessere Geräte, hochwertigere Materialien und dergleichen. Die dafür anfallenden Mehrkosten kann man nicht abziehen. Die gleiche Logik gilt bei einer Badezimmersanierung. Auch hier ist in der Regel ein Teil der Kosten als wertsteigernd einzuschätzen, weil es sich nicht nur um einen gleichwertigen Ersatz handelt, sondern meistens auch um Qualitäts- und Komfortverbesserungen. Klassiker in diesem Kontext: Ein herkömmliches WC wird mit einem teureren Closomat ersetzt, die einfache Duschbrause mit einer kostspieligen Regenduscheninstallation. Um auf Diskussionen mit dem Steueramt vorbereitet zu sein, ist es ratsam, Renovations- und Sanierungsarbeiten gut zu dokumentieren – nicht nur mit den zugehörigen Handwerkerrechnungen, sondern auch mit Vorher/Nachher-Fotos. Denn die Beweislast, wenn man sich gegen eine Einschätzung wehren will, liegt beim Steuerpflichtigen, nicht beim Steueramt.
Quelle: Treuhand | Suisse

Am 28. September hat die Stimmbevölkerung der Abschaffung des Eigenmietwerts zugestimmt. Damit fallen künftig auch die steuerlichen Abzüge für Unterhalt und Sanierungsarbeiten am selbst genutzten Wohneigentum weg. Jetzt bleibt noch Zeit, um anstehende Projekte voranzutreiben.
Es steht noch nicht fest, wann die reformierte Besteuerung von Wohneigentum in Kraft tritt. Der Entscheid liegt beim Bundesrat und auch die Kantone haben noch Hausaufgaben zu erledigen. Jetzt dürfte es für viele Wohneigentümer interessant sein, anstehende Sanierungsprojekte am selbstgenutzten Wohneigentum anzugehen, um noch von den bisherigen Abzugsmöglichkeiten zu profitieren.
Richtig einschätzen
Die meisten Wohneigentümer sind mit der Unterscheidung nach «werterhaltenden» (abzugsberechtigt) und «wertvermehrenden» (nicht abzugsberechtigt) Aufwendungen vertraut. Als werterhaltend gelten beispielsweise ein neuer Fassadenanstrich, eine Balkonsanierung, der Ersatz eines Teppichbodens, der Fensterläden oder des Garagentors durch ein gleichwertiges Modell. Bei vielen Sanierungsprojekten überschneiden sich diese beiden Kategorien aber. Bei einer Küchensanierung zum Beispiel trägt zwar der Grossteil der Kosten zum Werterhalt bei.Meistens beinhalten solche Projekte aber auch wertvermehrende Elemente: mehr und bessere Geräte, hochwertigere Materialien und dergleichen. Die dafür anfallenden Mehrkosten kann man nicht abziehen. Die gleiche Logik gilt bei einer Badezimmersanierung. Auch hier ist in der Regel ein Teil der Kosten als wertsteigernd einzuschätzen, weil es sich nicht nur um einen gleichwertigen Ersatz handelt, sondern meistens auch um Qualitäts- und Komfortverbesserungen. Klassiker in diesem Kontext: Ein herkömmliches WC wird mit einem teureren Closomat ersetzt, die einfache Duschbrause mit einer kostspieligen Regenduscheninstallation. Um auf Diskussionen mit dem Steueramt vorbereitet zu sein, ist es ratsam, Renovations- und Sanierungsarbeiten gut zu dokumentieren – nicht nur mit den zugehörigen Handwerkerrechnungen, sondern auch mit Vorher/Nachher-Fotos. Denn die Beweislast, wenn man sich gegen eine Einschätzung wehren will, liegt beim Steuerpflichtigen, nicht beim Steueramt.
Noch rasch ein Wintergarten?
Auch wenn man es als Wohneigentümer gerne anders sehen würde: Es gibt Bauprojekte, die sind aus Sicht des Steueramts definitiv wertvermehrend – und damit nicht vom steuerbaren Einkommen abzugsfähig. Dazu zählt beispielsweise der Ausbau des Dachstocks, der Einbau eines zusätzlichen Badezimmers, das Erstellen eines Wintergartens oder der Bau eines Schwimmbads. Die Investitionen dafür fallen steuerlich erst bei einem späteren Verkauf der Liegenschaft ins Gewicht, indem sie zu einer Reduktion der Grundstücksgewinnsteuer beitragen.Privilegierte Energiesparmassnahmen
Massnahmen, die zum Umweltschutz beziehungsweise zur Verbesserung der Energiebilanz in den eigenen vier Wänden beitragen, werden steuerlich privilegiert. Zu den klassischen Sanierungsprojekten gehören beispielsweise der Ersatz der Fenster mit energieeffizienteren Modellen, die Verbesserung der Fassadendämmung oder der Wechsel auf ein modernes Heizungssystem. Die damit verbundenen Aufwendungen kann man vollumfänglich abziehen. Dementsprechend sind auch die Kosten für den Einbau einer Photovoltaik-Anlage gesamthaft vom steuerbaren Einkommen abzugsfähig. Es versteht sich von selbst, dass alle diese Kosten dokumentiert werden müssen, namentlich mit den Rechnungen der beteiligten Auftragnehmer. Sobald die revidierte Besteuerung von Wohneigentum in Kraft tritt, entfällt diese steuerliche Privilegierung bei der direkten Bundessteuer. Den Kantonen ist es – maximal bis ins Jahr 2050 – freigestellt, den Abzug für Energiesparen und Umweltschutz noch zu gewähren.Ladestation abzugsfähig?
Und wie ist es mit der Ladestation für das Elektroauto? Die Steuerabzüge, die man als Eigenheimbesitzer für diese Kosten vornehmen kann, sind kantonal unterschiedlich. Die grosse Mehrheit der Kantone gewährt höchstens einen teilweisen Abzug. Voraussetzung ist, dass es sich um eine bidirektionale Anlage handelt. Also eine Anlage, die nicht einfach dem Betanken des Fahrzeugs dient, sondern in eine Photovoltaik-Lösung für die Liegenschaft eingebunden ist, bei der die Autobatterie auch als Energiespeicher für die Liegenschaft genutzt werden kann.Quelle: Treuhand | Suisse

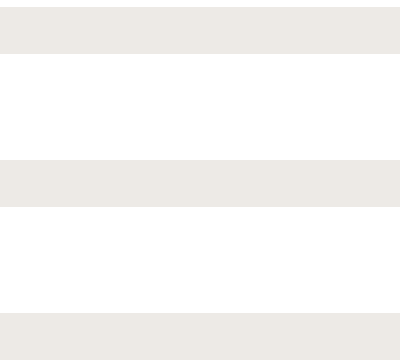
 Startseite
Startseite Dienstleistungen
Dienstleistungen Team
Team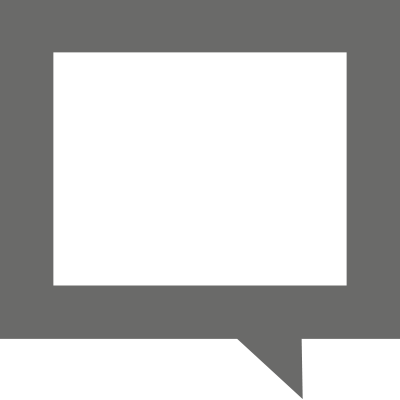 Kontakt
Kontakt



